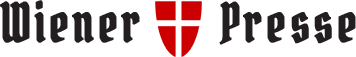„Wiener Zeitung“: Frau Ebrahimi, Sie sind relativ spät – mit Ende 30 – literarisch in Erscheinung getreten, und dann gleich mit dem meisterhaft erzählten Roman „Sechzehn Wörter“, für den Sie den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises erhalten haben. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Nava Ebrahimi: Mit 27 beim „Open Mike“-Wettbewerb hatte ich einen ersten größeren Auftritt in der Öffentlichkeit und dazwischen auch ein paar kleine Veröffentlichungen. Ich hatte aber bereits als Kind in der Volksschule Freude am Schreiben. Bei uns zu Hause gab es – obwohl meine Eltern beide Akademiker sind – keine Bücher. Durch die Migration ist alles verloren gegangen. Deutsche Bücher haben meine Eltern nicht gelesen, iranische Bücher gab es damals nicht so leicht in Deutschland zu bekommen – und sie hätten ohnehin keine Zeit gehabt zum Lesen. Das ist etwas paradox: Ich bin gewissermaßen bildungsfern aufgewachsen, aber mit dem Selbstverständnis von Akademikern.
Haben Sie Märchen erzählt bekommen?
Was bei uns immer vorhanden war, waren Familiengeschichten, die weitererzählt wurden – vor allem, wenn Verwandte aus dem Iran da waren. Das Erzählen hat schon eine große Rolle bei uns gespielt, das könnte eine Quelle sein. Ich habe aber früh gemerkt, dass mir das schriftliche Erzählen Freude macht. Das Gestalten, Sätze formulieren, eine Rhythmik herstellen – das hat mich schon früh begeistert.
In Ihren Texten finden sich sehr viele treffende Details, die mit einem Satz, oft nur einem Halbsatz, eine Szene oder Person charakterisieren. Wie kommt es zu diesem Gespür für Details?
Ich kann nicht sagen, woher das kommt. Beobachten war schon immer etwas, was ich getan habe, vielleicht auch tun musste anfangs. Wenn man mit den Eltern migriert, die sich in der neuen Gesellschaft orientieren müssen, die erst einmal Codes entschlüsseln müssen, dann ist man als Kind darauf eingestellt, selbst zu beobachten und zu sehen: Welche Regeln herrschen hier, was macht man, was macht man nicht? Ich habe schon früh Menschen beobachtet.
Nava Ebrahimi im Gespräch mit Werner Schandor.
– © Anna Lisa Kiesel
Hatte Ihre Arbeit als Journalistin einen Einfluss auf Ihr literarisches Schreiben?
Ja, vielleicht. Meine journalistische Ausbildung war sehr praktisch ausgerichtet. An der Journalistenschule gab es sehr intensive Lehrredaktionssitzungen, wo jeder Text auf Herz und Nieren überprüft wurde. Das hat mir ein Stück weit sicher geholfen, was Präzision angeht – und auch den Willen zur Verständlichkeit.
Alle Hauptfiguren in Ihren Büchern – Mona in „Sechzehn Wörter“, Ali Najjar und Sina in „Das Paradies meines Nachbarn“ – sind durch und durch säkular veranlagt. Das führt mich zur Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit der Religion?
Mein Vater war Kommunist und hatte mit Religion gar nichts am Hut. Aber es ist schwer zu trennen: Was ist Kultur, was Mentalität, was Religion? Das hängt zusammen. Mein Vater hat sich nicht gegen den täglich praktizierten Glauben ausgesprochen, und er hätte auch kein Familienfest torpediert, nur weil dort ein religiöses Zeremoniell abgehalten wurde. Meine Mutter ist zwar in einer gewissen Weise religiös, aber nicht an den Islam gebunden. Ich muss dazu sagen: In meiner Familie – und damit meine ich die Großfamilie – ist Religion eher ein verbranntes Terrain. Und so geht es, glaube ich, vielen Iranerinnen und Iranern. Nichtsdestotrotz: Ich bin kein unreligiöser Mensch. Die Frage nach Gott in einer wie immer gearteten Form bzw. das metaphysische Bedürfnis in uns wird mich wahrscheinlich ein Leben lang beschäftigen, aber ich brauche keine religiöse Institution dafür. Als kulturelle Leistung finde ich Religion sehr interessant. Zum Islam habe ich zwar keine Verbindung, ich sage allerdings in manchen Situationen aus rationalen Überlegungen heraus, dass ich Muslimin bin – weil es ganz viele Musliminnen gibt wie mich, die niemals von sich sagen würden, dass sie Musliminnen sind. Und wenn es Leute wie ich nicht sagen, sondern nur Menschen, die den Islam für sich enger auslegen, dann verzerrt es natürlich das Bild.
In „Sechzehn Wörter“ gibt es die Szene, wo die Hauptfigur Mona ein Wohnhaus verlässt, und eine ältere Frau erinnert sie vor dem Rausgehen daran, dass sie kein Kopftuch trägt. Dann steht der Satz: „Das Kopftuch – als ob ich eine Wahl hätte.“ In Europa haben die Frauen eine Wahl. Wie beurteilen Sie den Griff nach dem Kopftuch hier? Ist es ein Akt der religiösen Selbstbestimmung, als den es beispielsweise die deutsche Autorin Kübra Gümüşay interpretiert?
Auch das ist schwierig. Da bin ich durch meine Familiengeschichte geprägt. Ich bin ganz klar mit dem Narrativ aufgewachsen: „Als die Mullahs kamen, zwangen sie uns das Kopftuch auf.“ Ich akzeptiere es, wenn jemand wie Kübra Gümüşay das Kopftuch als Zeichen der Selbstbestimmung sieht, und ich nehme ihr das auch ab. Ich selbst komme da aber nicht mit.

„Ich akzeptiere es, wenn jemand das Kopftuch als Zeichen der Selbstbestimmung sieht – für mich bleibt es im Tiefsten meines Herzens ein Unterdrückungssymbol.“
– © Anna Lisa Kiesel
Für mich bleibt das Kopftuch im Tiefsten meines Herzens ein Unterdrückungssymbol. Die Frauen, die den Schah mitgestürzt haben – und da waren viele Frauen dabei -, haben oft Kopftuch getragen als Zeichen gegen den Imperialismus. Da war das ein Akt der Befreiung. Aber als sie das Kopftuch danach wieder ablegen wollten, wurde es ihnen verboten. Und es gab den berüchtigten Spruch: „Kopftuch auf oder Schläge auf“ – was sich im Persischen reimt. Ich verstehe Frauen, die im Westen Kopftuch tragen und sagen: „Ist es ein Zeichen der Befreiung, wenn jeder Sanitärinstallateur mit einer nackten Frau wirbt? Ist das besser?“ – Ich finde es aber auch schwierig, das so aufzurechnen. Ich versuche immer wieder, das Kopftuch wie jedes andere religiöse Symbol zu sehen, aber ganz gelingt es mir nicht… Das ist ein Thema, da würde ich mich von mir aus nicht öffentlich dazu äußern oder ein Meinungsstück schreiben, weil ich weiß, dass ich zu sehr von unserer Familiengeschichte geprägt bin… Es gibt Themen, glaube ich, da kommt man aus seiner Haut kaum raus.
In den 1960ern/70ern gab es die Forderung, Literatur müsse politisch sein. Das wiederholt sich jetzt in gewisser Weise. Kunst soll heute nicht nur politisch, sondern auch politisch korrekt sein. Das geht bis hin zur Ansicht, männliche europäische Übersetzer könnten sich nicht ins Innenleben schwarzer amerikanischer Frauen hineinversetzen und sollten daher ihre Texte nicht übersetzen. So wurde es zumindest im Fall von Amanda Gormans Gedicht „The Hills We Climb“ diskutiert. Was halten Sie von dieser Sichtweise? Und: Wie stehen Sie zur Praxis, Trigger-Warnungen auszusprechen, wenn Leser-Gefühle durch ein Buch verletzt werden könnten? Müsste man nicht auch vor Ihren Büchern warnen, wenn es um Krieg und Kriegsversehrte geht? – Plumpe Frage: Darf Literatur unkorrekt sein? Und dürfen Sie als Frau überhaupt über Männer schreiben?
… und noch viel krasser: über einen Kriegsveteranen, der im Rollstuhl sitzt!? Das ist keine plumpe Frage. Das ist eine höchst aktuelle, schwierige Frage. Für mich kann es nur einen Mittelweg geben. Vorab würde ich sagen: Literatur und Kunst sollen alles dürfen. Literatur lebt und stirbt damit, dass wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller völlig frei sind und unser Unterbewusstsein anzapfen und neue Verbindungen herstellen, da darf keine Kontrollinstanz im Weg stehen. Das ist wie in Träumen, die auch völlig frei sind von Wertvorstellungen. Nur so kann Neues, nur so können bewegende Werke entstehen. Das von vornherein einzuschränken, ist höchst gefährlich. Daher würde ich grundsätzlich sagen: Nein, keine Einschränkung!
Auf der anderen Seite ist eine Sensibilisierung nie schlecht. Wenn wir uns Dinge bewusster machen und uns in neue Positionen hineinversetzen, dann erweitern wir im Idealfall unseren Empathiehorizont – und auch den unserer Leserschaft. Insofern ist es immer gut, sich mit Minderheitenthemen zu beschäftigen und die Welt probeweise aus deren Sicht zu sehen. Aber es wird schon auch schwierig. Die Figur des Ali Reza in „Das Paradies meines Nachbarn“, die ich aus der Perspektive eines Menschen, der im Rollstuhl sitzt, geschrieben habe – ich weiß nicht, ob ich mich das heute noch trauen würde. Vermutlich schon, weil ich nicht anders könnte.
Wär ja schade um die Figur.
Ja, wär schade drum… Das ist ja das Großartige an Literatur, dass sie individuelle Grenzen überwinden kann, immer wieder. Denn die Konsequenz wäre, dass wir nur noch aus der eigenen Perspektive schreiben können, und das kanns nicht sein. Auch da kann es für mich nur differenzierende Antworten geben. Es hängt extrem vom Kontext ab – und davon, wie ich es literarisch umsetze und zu welchem Zweck.

US-Lyrikerin Amanda Gorman bei Ihrer poetischen Inaugurationsrede für Präsident Joe Biden am 20. Jänner 2021.
– © Patrick Semansky / POOL / AFP
Was ich aber noch wichtig finde: Dass man sich nicht so leicht in das Schema Dafür oder Dagegen pressen lässt. Manche Menschen empören sich sehr schnell und rufen „Cancel Culture“. Aber wichtiger wäre es, die angestoßene Debatte erst einmal offen zu führen und als Chance zu begreifen. Nehmen wir den vieldiskutierten Fall rund um Amanda Gorman: Soweit ich mich erinnere, hat eine holländische Journalistin, selbst Schwarze, in einem Kommentar bemerkt, dass es ein gutes Zeichen gewesen wäre, den Auftrag für die holländische Übersetzung von „The Hill We Climb“ an jemanden zu vergeben, der auch Rassismus erfahren hat und im Literaturbetrieb unterrepräsentiert ist. Das griffen dann Menschen auf, die identitätspolitische Debatten grundsätzlich als Gefahr für die Demokratie ablehnen, und spitzten es zu der Aussage zu: Jetzt dürfen wohl nur noch Schwarze Frauen Schwarze Frauen übersetzen! Und schon haben wir eine Front. Dass Verlage vorauseilend bereits engagierten Übersetzerinnen und Übersetzern den Auftrag für „The Hill We Climb“ entzogen, machte die Sache nicht besser. Das hat die Debatte natürlich verschärft. Aber ich würde immer dafür plädieren, genau hinzusehen: Wie genau ist die Debatte entstanden? Enthält sie im Kern womöglich die Chance auf neue Erkenntnisse? Man muss immer genau hinsehen.

In „Sechzehn Wörter“ heißt es an einer Stelle über Deutschland: „Wie sehr sich jeder in diesem Land bemühte, alles richtig zu machen, es war unerträglich.“ Wie schaut es mit Österreich aus: Sind die Menschen hier auch so richtigkeitsversessen? Wie ist Ihre Beobachtung nach zehn Jahren in Graz?
In Österreich ist das schon anders. Auf der einen Seite erschreckt es mich manchmal, was man hier öffentlich sagen kann, was in Deutschland undenkbar wäre. Auf der anderen Seite ist es manchmal angenehm zu sehen, dass hier nicht jeder so krass unter Druck steht, ja nichts Falsches zu sagen. In Deutschland ist die Überkorrektheit und das Bemühen, in allem Erster, auch in moralischen Fragen Klassenbester zu sein, sehr stark. Was daran unangenehm ist, ist der Verdacht, dass, wenn man sich so sehr zusammenreißen muss, vielleicht unter der Oberfläche etwas lauert, das man mit aller Gewalt verheimlichen will; dass einem die Leute etwas vorspielen. Generell, so meine Wahrnehmung, ist das Bewusstsein, bei den Nazi-Verbrechen auf der Seite der Täter gestanden zu haben, in Österreich viel weniger ausgeprägt.
Ihre Rede zur Wiedereröffnung des Burgtheaters im Oktober 2021 läuft auf den Satz hinaus: „Mit allem, was wir in Moria, an den EU-Außengrenzen und in Afghanistan zulassen, haben wir jeglichen Anspruch auf moralische und zivilisatorische Überlegenheit verwirkt.“ – Wer ist „wir“? Und: Wie könnte man in Deutschland und Österreich zu einem humaneren Umgang in der Flüchtlingsfrage finden, ohne die Angst vor Überforderung oder Überlastung in der Bevölkerung zu vertiefen?
Mit dem „Wir“ meine ich westliche Gesellschaften und Menschen wie mich, die in diese Gesellschaften migriert sind. Viele von uns haben diesen rassistischen Blick selbst übernommen, auch ich bin nicht frei davon. In erster Linie ging es mir – völlig unabhängig von politischen Forderungen – darum, dieses Überlegenheitsgefühl bewusst zu machen, unsere Weltsicht, die nach wie vor so kolonial ist. Vieles, was östlich oder südlich von Griechenland stattfindet, wird mit einer arroganten westlichen Haltung betrachtet. Alles, was anders ist, wird ganz schnell als unterlegen oder weniger zivilisiert betrachtet. Auch die Überlegenheitsgeste der USA, mit Waffen in den Irak und nach Afghanistan zu gehen, um den armen Menschen die Demokratie zu bringen – das musste scheitern.
Und was die Flüchtlingsproblematik betrifft…?
Auch da sage ich nicht, dass es einfach ist. Aber die österreichische Regierung unter Sebastian Kurz hat bei den Versuchen der EU, eine gemeinsame, solidarische und humanitäre Lösung etwa für die Menschen in Moria zu finden, keine konstruktive Rolle gespielt, im Gegenteil. Da wurde auf dem Rücken von Flüchtlingen ein spalterischer Weg eingeschlagen. Auch deshalb ist die EU so erpressbar geworden – und das wiederum erklärt die katastrophale Lage an der belarussischen Grenze. Österreich hat zudem 2018 alle Programme zur humanitären Aufnahme besonders schutzbedürftiger Personen gestoppt. Das, finde ich, ist beschämend. Und diese populistische Politik – manche ahnten es – war ein Ablenkungsmanöver, wie jetzt durch die „Chats“ immer klarer wird. Es schadet übrigens zuallererst den Menschen in Österreich, Angst vor Einwanderung zu schüren, anstatt die wirklich wichtigen Themen anzugehen: Klima, Beschäftigung, Bildung und Soziales.